Thomas Haemmerli zur Besetzerszene: «Für mich ist das ein bisschen eine Autistengeschichte.»
Thomas Haemmerli war früher Teil der 80er-Bewegung und Hausbesetzer. Zuweilen träumte er davon, in der Guerilla für den Fortschritt zu kämpfen. Heute besitzt er eine Wohnung in einem gentrifizierten Quartier Zürichs, und streitet mit seinem Gentrifizierungsfilm für dichtere Städte. Ein Gespräch.

Die Gelateria di Berna wurde mit Farben verschmiert. Auf den Fenstern stand: «Klasse gegen Glacé» oder «Aufwertung einfrieren». Hätte diese Aktion vor dreissig Jahren stattgefunden, wärst du dabei gewesen?
Schwierig zu sagen, weil man damals gegen andere Sachen vorgegangen ist. Aber schon damals hat mich vor allem die Frage interessiert, was eine Aktion politisch auslösen oder bewirken kann. Wenn du im Rahmen einer grösseren Bewegung mit politischen Forderungen an vielen Orten Widerstand leistest, dann kann das etwas bringen. Aber so eine vereinzelte Aktion, nachdem die Strasse ja schon verkehrsberuhigt ist, nachdem die meisten Häuser renoviert und die Eigentumswohnungen verkauft sind, danach ist das etwas witzlos. Für mich ist das ein wenig eine Autistengeschichte. Oft verwechselt man kulturelle Symptome mit ökonomischen Prozessen.
Wie meinst du das genau?
Simpel gesagt, wenn jemand kommt, der aussieht wie du, mit Dreadlocks, und Capuccino trinkt, dann sagt das etwas aus über die kulturelle «Hypsterisierung», aber nicht darüber, wie teuer oder billig eine Wohnung ist. In dem Sinne sind sie an der falschen Stelle. Wobei: Ich mache mich im Film ja auch lustig über die Gelateria di Berna, die in der Tat ein Gentrifizierungssymptom ist. Und den Wortwitz mochte ich: «Klasse gegen Glacé». Aber da sind dann auch noch Hammer und Sichel. Schon in den 80er Jahren hat der Teil der Bewegung, bei dem ich war, via den anarchistischen Buchladen Paranoia City viel mitgekriegt über dissidente Bewegungen im Kommunismus. Über den Spanischen Bürgerkrieg. Und nach allem, was ich heute weiss, bin ich etwas empfindlich auf Totalitarismus. Es entstehen überall, wo der Kommunismus herrscht, Gulags, Straflager. Vor mehr als zehn Jahren habe ich mir die Revolution in Venezuela unter Chavez angeschaut, und fand den korrupten autoritären Kontrollstaat schon damals grauenhaft. Von dem her, das ist nicht meine Abteilung.
Damals fanden viele: Neubau ist immer pfui.
Im Film beleuchtest du deine Vergangenheit in der Besetzerszene kritisch und ironisch. Du hinterfragst auch, ob mit Besetzungen tatsächlich etwas gegen Gentrifizierung gemacht werden kann.
Im Film kritisiere ich konkret, was an der Besetzung der Hellmutstrasse passierte. Als wir legalisiert und von der linken Genossenschaft Wogeno übernommen wurden, war auch ein Neubau geplant – vorher hatte es ein paar Werkstätten gegeben. Der Reflex: Ja nix abreissen! Das fand ich damals schon verkehrt, ich war dafür, dass man auch etwas Neues baut. Es gab dann einen Kompromiss. Man hat statt fünf Stockwerken nur vier gebaut. Damals fanden viele: Neubau ist immer pfui. Das ist natürlich kurzsichtig, denn das sind heute relativ billige Genossenschaftswohnungen. Die damaligen Ex-Besetzer haben einen zusätzlichen Stock und damit günstigen Wohnraum verhindert. Ich bin im Film dann polemisch und mach mich lustig über die Wohnungsnotbewegung, zu der ich gehörte. Die Antwort auf ihren Slogan «WoWoWohnige?» sind auch die nicht gebauten Wohnungen des fünften Hellmi-Stocks.
Die Hellmi ist aber nur ein Einzelbeispiel.
Wenn die These meines Films stimmt, nämlich, dass wir mehr Wohnraum brauchen, weil wir länger leben, weil Väter nach der Trennung ihre Kinder aufwachsen sehen wollen, weil mehr als 50% in Einpersonenhaushalten lebt usw., dann braucht man, auch ohne Zuwanderung zwingend mehr Wohnraum. Oder man müsste den Wohnraum pro Person verringern, was nicht sehr realistisch ist. Es stellt sich also die Frage, wer den zusätzlich gebrauchten Wohnraum schafft und wo? Und wenn Besetzer einen zusätzlichen Stock, wohlgemerkt einen zusätzlichen Stock Genossenschaftswohnungen, verhindern, dann ist das natürlich totaler Schwachsinn.
Wer in der Schweiz auf die Welt kommt, ist automatisch privilegiert.
Besetzungen bringen also nichts?
Nein, nein. Ich kritisiere lediglich, dass die heutige Besetzerbewegung ein bisschen tumb ist, indem sie nicht oder kaum kommuniziert. Bei den verschiedenen Besetzungen, an denen ich beteiligt war, ging es immer darum, dass man eine politische Botschaft hatte. Als ich die Ballenbergbesetzung organisierte, bin ich mit einem Plastiksack Zwänzgerli ans Münztelefon und habe mit allen Lokalradios in der Schweiz telefoniert, um zu erklären, dass das Kapital der Pensionskassen, das in den Häusermarkt einfliesst, die Wohnungen teurer macht. Ich kritisiere die fehlende Kommunikation. Ansonsten ist das Positive an Besetzungen natürlich, dass Hausbesitzer Sachen nicht leer stehen lassen. Besetzungen sind ein Hort für kreative Subkulturen. Und sie sind eine Schule, an der du lernst, etwas zu organisieren, zu argumentieren, dich durchzusetzen. Früher galt in der Schweiz eine Offizierslaufbahn als Vorbereitung für Kaderstellen. Die radikale Linke war das auch immer, du lernst wie man etwas macht, wie man mit Gruppendynamik umgeht, Konflikte aushält. Und, und, und. Aber Besetzungen sind etwas auf Zeit. Entweder sie werden geräumt oder sie werden legalisiert und dann verbürgerlicht das recht schnell, zum Beispiel in Kreuzberg in Berlin.
Du inszenierst dich bewusst als Gewinner. Du zeigst deine Privilegien, die du aufgrund deiner sozialen Herkunft hattest. Du legst alle Karten offen auf den Tisch: Schaut her, ich bin Teil des Problems, «die Gentrifizierung, das bin ich!» Das deute ich auch als Versuch, aufrichtig zu sein. Welcher kritische Zugriff zur Thematik wolltest du mit diesem Gestus eröffnen? Denn nur, weil du eingestehst, Teil des Problems zu sein, heisst das natürlich nicht, dass du nicht mehr Teil des Problems bist.
Es ist klar, dass ich auch ein Teil des Problems bin. Einerseits geht es mir darum, zu zeigen, dass wir alle in relativ komplexen Lebenssituationen drinstecken. Beispiel: Sobald du irgendwo angestellt bist, hast du eine Pensionskasse, die dein Geld in Immobilien und Aktien anlegt. Und wenn man sich Richtung Pension bewegt, hofft man, dass sie dabei Profite machen. Zweitens: Mich interessieren nicht so sehr moralische Fragen. Ich hätte den Film genauso gut machen können, indem ich Beispiele besonders gewissenloser Hausbesitzer gedreht hätte, und dann denen eine sympathische, arme 80-jährige Dame entgegenstelle, die aus ihrer Wohnung raus muss, in der sie mit ihrem Mann und vielleicht noch ihren Kindern wohnte. Damit erweicht man das Herz und schafft folgenfreie Empörung. Für mich uninteressant. Mich interessieren ökonomische Mechanismen.
Zum Beispiel?
Ich kenne ja tonnenweise Linke in der Stadt, die in sehr grossen Wohnungen sind. Wenn man eine Familie hat und dann gehen deine Kinder raus, dann bleibst du in einer zu grossen Wohnung. Vom gesamtgesellschaftlichen Wohl aus betrachtet, müsste man da raus, aber selbst eine kleinere, neue Wohnung ist dann halt teurer. Mich interessieren solche Fragen viel mehr als die Frage, ob ich jetzt unbedingt ein guter Mensch bin oder nicht. Bezüglich der Privilegien: Wenn man autobiographisch arbeitet, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Mir war es wichtig, mich selber zu demontieren. Und: Leute vertreten Positionen ja oft aufgrund biographischer Stationen. Deshalb das Biographische. Was die Privilegien anbelangt: Wer in der Schweiz auf die Welt kommt, ist automatisch privilegiert. Wenn du einen anständigen Job hast, verdienst du ordentlich.
Die Linken vergessen oft den privaten Wohnungsbau, der auch wichtig ist.
Im Film teilst du oft nach Links und Rechts aus. Du greifst besonders das Selbstverständnis der linken sozialdemokratischen Stadtregierung an. Was genau macht die linke Stadtregierung falsch?
Dass sie zu wenig verdichtet, dass sie zu wenig zulässt, dass man dichter bauen kann. Und dass sie das Problem nur über Genossenschaften lösen will. Sie sind ja sehr stolz, das Zürich per Gesetz 30% Genossenschaftsanteil anstrebt. Das ist alles schön und gut, aber das heisst, 70% sind nicht in Genossenschaften, und die müssen auch irgendwie wohnen und ihre Miete bezahlen können. Oder eben: Kaufen. Hat man keine Familie, ist es ja nicht so einfach, in eine Genossenschaft oder eine städtische Wohnung zu kommen. Die Linken vergessen oft den privaten Wohnungsbau, der auch wichtig ist. Dort gilt nämlich langfristig: Je knapper das Angebot, desto höher sind die Preise. Zwar schützt das Mietrecht vor Mietaufschlägen, aber sobald renoviert wird, lässt sich das umwälzen. Und wenn es profitmässig interessant genug ist, zu renovieren, dann wird renoviert.
Man sagt ja oft, es brauche mehr günstige Wohnungen, aber was man oft vergisst, ist das Problem, dass wenn es keine teuren Wohnungen gibt, dann schmeissen sich die Reichen auch auf die günstigen Wohnungen, was die Konkurrenz auf dem Segment erhöht.
Richtig.
Aber ist nicht gerade das eine der vielen Widersprüchlichkeiten, die der freie Wohnungsmarkt hervorbringt? Was uns zu der Grundsatzfrage führt, ob wir dem freien Markt die Kontrolle des Wohnungsmarktes überlassen wollen oder soll die Stadt, die halt auch einer gewissen demokratischen Kontrolle unterliegt, hier eingreifen? Es geht schliesslich auch um die Frage, wer denn überhaupt die gesellschaftliche Struktur einer Stadt steuern sollte.
Wohnbau ist wahnsinnig komplex, deshalb kann man keine einfachen Schuldzuweisungen machen. Bauen ist gleichzeitig auf den Stufen Bund, Kanton und Stadt geregelt. Was die demokratische Kontrolle anbelangt: Über die Bau- und Zonenordung (BZO) kontrolliert die Stadt ja schon recht stark, wie gebaut wird. Dabei gibt es aber einen Unwillen, aufzuzonen, also mehr Wohnungen zu bauen. Aus drei Gründen: 1. Wenn man irgendwo zwei Stockwerke mehr erlaubt, dann wird renoviert, die beiden Stockwerke kommen dazu, die Wohnungen werden teuer. Oder man baut gleich ganz neu, weil sich damit noch mehr verdienen lässt. 2. Die Kantone müssen eine Mehrwertabschöpfung vorschlagen, das heisst, wenn durch Aufzonung ein Grundbesitzer mehr erhält, muss er dafür etwas bezahlen. Der bürgerlich regierte Kanton Zürich hat da etwas in der Pipeline, das für die Stadt aber nicht taugt. Wenn man mehr baut und verdichtet, hat die Stadt das Problem, dass Kosten entstehen für Schulhäuser, für Infrastruktur. Dass die Stadt kein taugliches Instrument zur Mehrwertabschöpfung hat, ist ein Dilemma. Also: Kurzfristig wird es dort, wo man aufzont eher teurer. Aber langfristig senkt ein energisch ausgeweitetes Angebot die Mieten. Das sieht man jetzt in der Agglo, wo da und dort wegen der vielen Bauten die Mieterschaft plötzlich am längeren Hebel sitzt. Man sieht es beim Markt für Büros in Zürich, weil es davon genug gibt. Und man sieht es im Segment für Luxuswohnungen, die sich nicht mehr vermieten lassen.
Ab den Sechzigern kommt bei der Rechten die Idee auf, dass man physische Schollenverbundenheit braucht, und dass das Hochhaus krank mache.
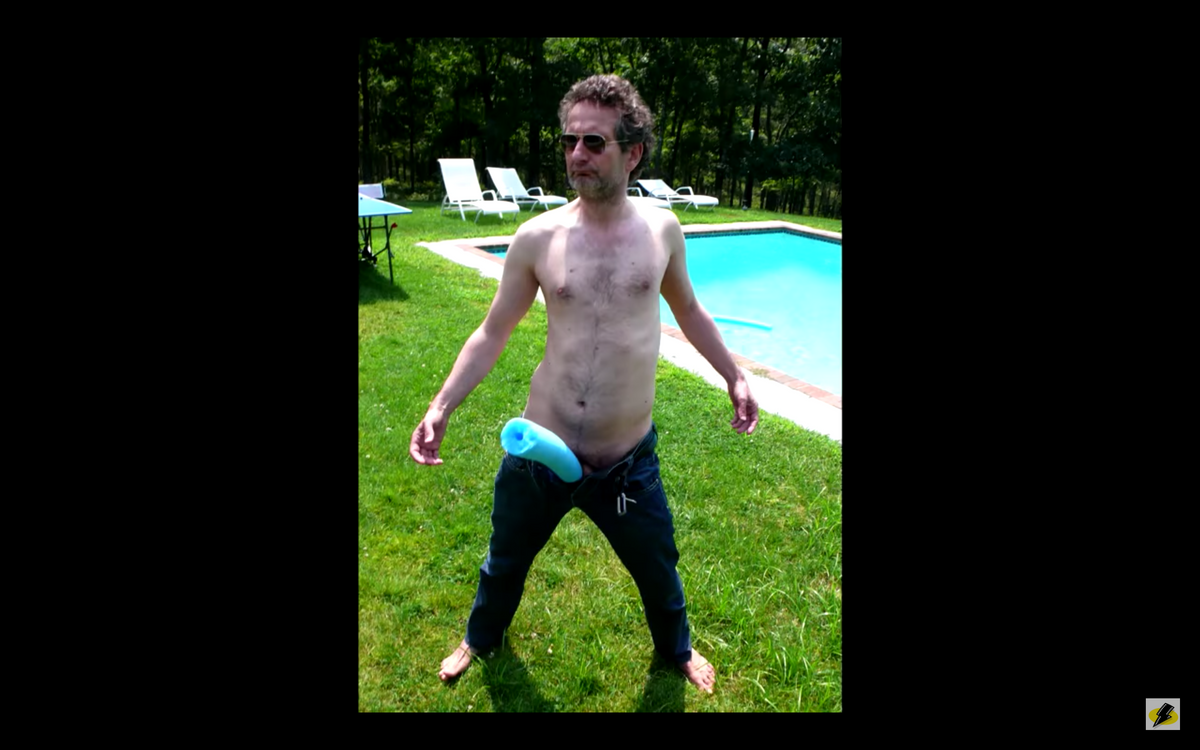
Der Interviewte hat erlaubt, dass wir dieses Bild verwenden. (Bild: Screenshot/Trailer)
Im Film deutest du diesen Widerstand gegen ein verdichtetes städtisches Wohnen auch als Furcht vor der Moderne. Die Stadt, mit ihren kahlen Betonblöcken, beschwor in der Vergangenheit den Mythos des «entwurzelten Stadtmenschen» herauf, dessen Handlungsautonomie unter der Flut technischer Rationalisierungen zu ersticken drohte. Dem stellte man eine nachbarschaftliche Idylle entgegen. Den Rechten galt diese als Lokus ethnisch-nationaler Homogenität, den Linken diente sie der Wiedererlangung kollektiver Handlungsfähigkeit. Lässt sich das aktuelle Missbehagen auch aus einer solchen Furcht erklären?
Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders zeichnen. Das erste: Die Schweiz hat sich immer als Bauernnation imaginiert. Das geht schon auf die Staatsgründung zurück. Die Liberalen, die damals den modernsten Staat in Europa schufen, setzten auf die alten eidgenössischen Mythen, um die Konservativen einzubinden. Ein Paradebeispiel dafür ist der Maler Albert Anker, der in Paris lebte, einer richtigen Grossstadt. Und die Schweiz war ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits ziemlich industrialisiert. Anker aber malt nur diese Bauernidylle. Der ist nicht umsonst Blochers Lieblingsmaler. Mit dem zweiten Weltkrieg kam die geistige Landesverteidigung, die das Ländliche der Schweiz betonte, die antistädtisch war und antimodern. Und das geht nach den Kriegen nahtlos über in den Kalten Krieg. Und auch heute noch gibt es keine Bevölkerungsgruppe, die so überproportional viel Macht besitzt wie die Bauern. Jedenfalls: Ab den Sechzigern kommt bei der Rechten die Idee auf, dass man physische Schollenverbundenheit braucht, und dass das Hochhaus krank mache. Bei den Linken ist es die neomarxistische Kritik, die glaubt, dass der Plattenbau krank macht, weil der Mensch in diesen Einheiten zum Konsumenten konditioniert werde.
Im Grunde die Künstlerkritik der 68er. Man befürchtete, der Kapitalismus reduziere das Leben zur Warenform.
Genau. Und heute ist ja interessant, dass es eine Art Renaissance des Plattenbaus gibt. Diverse Forschungen zeigen, dass die Leute in den Göhner-Bauten und in Sozialsiedlungen relativ zufrieden sind. Klar, es gab früher Mängel. Die Wände zum Beispiel waren sehr dünn und man hörte alles. Diese Furcht vor dem Wohnblock ist aber immer noch in vielen Köpfen. Die GLP hat einen Vorstoss gemacht im Kantonsrat, dass man eine Hochhauszone in Zürich mache, bei der die üblichen Einschränkungen nicht gelten würden. Heute ist es ja so, dass ein Hochhaus kein Mittel der Verdichtung sein soll, man also viel Platz rundherum lassen muss. Die GLP schlug also vor, dass man ein paar Hochhäuser nebeneinanderstellen und wirklich verdichten könnte. Alle Linken und alle Rechten waren dagegen. Natürlich aus verschiedenen Gründen, aber das sind immer noch diese oft irrationalen Abwehrreflexe. Diese Gewissheiten sollte man aufbrechen und die Diskussion in Gang setzen.
Wenn man den Vergleich zu anderen Grossstädten zieht, New York oder Sao Paulo, dann ist klar, Zürich hat eine absolut geringfügige Hochhausdichte. Aber eine der dichtesten Städte in Europa ist Barcelona. Barcelona ist nicht wirklich eine Hochhausstadt. Vielleicht reicht es ja, wir bauen einfach zwei bis drei Stockwerke zusätzlich. Denn in der Schweiz stellt sich ja immer auch die Frage der Lebensqualität. Wollen wir wirklich so leben wie in Sao Paulo?
Ich schon!
Ja, aber viele Schweizer*innen sehen das anscheinend nicht so. Man muss allerdings anfügen, das Stimmvolk ist nicht per se gegen Verdichtungsbestrebungen. Ich denke hier an die Revision des Raumplanungsgesetzes oder an die Zweitwohnungsinitiative. Man ist für eine Verdichtung, nur nicht vor der eigenen Haustüre.
Ja und die Leute, die in Hochhäusern wohnen sind in der Regel auch zufrieden. Das Lochergut ist extrem beliebt, die Hardau-Hochhäuser genauso. Ich höre immer, wenn es um die Hochhausfrage geht, «die Leute seien eben dagegen.» Ich finde aber, man muss die Diskussion und diesen Streit suchen. Und nochmal, mir geht es ja nicht darum, Zürich zu einer kompletten Hochhausstadt zu machen und in gewissen Quartieren wäre eine Aufzonung vermutlich verkehrt, weil dort dann wirklich alles abgerissen und neugebaut würde. Ich sage nur, das Hochhaus ist ein mögliches Mittel, um relativ vielen Menschen auf knappem Boden eine Wohnung zu bieten. Mein Mantra ist bloss: Wir brauchen eine dichtere Stadt.
Eine Stadtentwicklerin hat ein schönes Bonmot für das Dilemma des Antigentrifizierungsaktivisten gefunden: Er kämpft dagegen, dass noch mehr seinesgleichen ins Viertel ziehen.
Im Film führst du die vielen Widersprüchlichkeiten vor Augen, in die die Gentrifizierungsdebatte führt. Das kann man an der Langstrassenaufwertung beispielhaft sehen. Die Stadt hat das Quartier beruhigt. Und im Prinzip ist ja niemand dagegen, dass man ein Quartier qualitativ aufwertet. Der Nebeneffekt ist allerdings immer eine gesteigerte Nachfrage, die zu Verdrängungseffekten führt. Auch ist es schwierig, in dieser Debatte einen konkreten Sündenbock fest zu machen. Ich denke hier an die Eröffnung des Hiltl Restaurants. Im Grunde hatte die Stadt da bereits vorgesorgt, indem sie das Quartier aufräumte. Problematisch ist, dass am Ende meistens die Bessergestellten profitieren. Es ist allerdings nicht klar, gegen wen genau man kämpfen muss, um der Gentrifizierung Einhalt zu gebieten. Für mich stellt sich deswegen die Frage, ob dieses Konzept überhaupt sinnvoll ist. Sollten wir nicht lieber darüber reden, wie wir in Zürich zusammenleben wollen oder was für eine Stadt wir wollen?
Interessante Frage. Im Film ist ja die Weststrasse drinnen. Die Karten wurden gespielt, als man sagte, da wird verkehrsberuhigt. Dann wird renoviert, und am Schluss kommt noch die Gelateria di Berna. Es ist ein Zuwachs an Lebensqualität, mit dem Resultat, dass die, die kein Geld haben, längerfristig rausfliegen. Wenn du also eine gemischte Stadt willst, dann musst du zwingend mehr Angebot schaffen durch mehr Dichte. Man hätte ja sagen können, wenn wir hier schon alles neu machen, dann lasst uns doch zwei bis drei Stöcke höher bauen. Noch interessanter wäre es, wenn es die Mehrwertabschöpfung in einer vernünftigeren Art gäbe.
Und das Konzept der Gentrifizierung?
Bei der Gentrifizierungsdiskussion bleibt man oft an der Oberfläche, an Lifestylephänomen. Dass das alte Quartiercafé durch ein neues ersetzt wird, das kann auch sein, weil der alte Wirt halt irgendwann mal in Pension geht. Dann kommen junge Gastronomen und machen etwas Neues. Und wenn die Videothek verschwindet, kommt ein Yogastudio. Das ist der Lauf der Dinge. Da arbeitet man sich oft am Falschen ab. Eine Stadtentwicklerin hat ein schönes Bonmot für das Dilemma des Antigentrifizierungsaktivisten gefunden: Er kämpft dagegen, dass noch mehr seinesgleichen ins Viertel ziehen.
Die WOZ hat vor vielen Jahren mal verschiedene Leute gefragt, welches Gebäude sie am liebsten sprengen würden. Ich wollte die ganzen dreistöckigen Genossenschaftsbauten in Oerlikon-Schwamendingen sprengen, weil darin die ganze SVP-Mischpoke haust.

Thomas Haemmerli ist für mehr Verdichtung (Bild: ZVG)
In der Vergangenheit gab es immer wieder Aufwertungsprozesse, und die führten nicht zwangsläufig zu einer Gentrifizierung. Zur Zeit der Weimarer Republik, als die ersten Wohnbaugesellschaften unter öffentlicher Trägerschaft aufkamen, ging es dort vor allem darum, die verelendeten Arbeiterquartiere massiv aufzuwerten. Das war kein Almosendienst, sondern eine gesellschaftspolitische Initiative, die der Integration der Arbeiterklasse diente, mit dem Anspruch: Jeder hat das Recht auf eine würdevolle Wohnung.
Klar, und heute haben wir Genossenschaften oder das Prinzip der Kostenmiete, wo keine Profitmaximierung dahinter steht. Wunderbar. Das Problem ist, es fehlen die Grundstücke, wo man sowas hinstellen könnte.
Die Stadt hat also längstens ihre Karten vergeben?
An vielen Orten schon. Die WOZ hat vor vielen Jahren mal verschiedene Leute gefragt, welches Gebäude sie am liebsten sprengen würden. Ich wollte die ganzen dreistöckigen Genossenschaftsbauten in Oerlikon-Schwamendingen sprengen, weil darin die ganze SVP-Mischpoke haust. Das ist ja das Quartier mit den meisten SVP-Wählern. Wurde natürlich nicht abgedruckt. Jedenfalls: Wenn wir jetzt sagen, ok, wir reissen da mal alles herunter, dann könnten wir da wirklich ein Hochhausquartier machen. Genossenschaftlich organisiert. Oder privat. Hohe Ausnützung. Oben teurere Wohnungen für Leute mit Geld, weiter unten Wohnungen, die dadurch subventioniert sind. Also da wäre schon noch ein bisschen was möglich. Man könnte natürlich auch eine Lenkungsabgabe machen, bei der man hohen Gebrauch von Wohnraum weniger attraktiv macht. Wobei man das, selbst wenn man es staatsquotenneutral machen würde, im bürgerlichen Kanton Zürich nicht durchkriegen würde. Das hat man in Deutschland nach dem Krieg gemacht, als extrem viel Wohnraum fehlte.
Es ist ein Privileg, dass man als Mann oder Frau nachts angetrunken durch die Stadt laufen kann, ohne ständig Angst zu haben.
Dein Film ist auch eine Absage an die Utopie zugunsten eines pragmatischen Sinnes für Realpolitik.
Ich brenne für Realpolitik und ganz konkrete Probleme. Das fing für mich schon in den 80ern an. Anfang der 80er Jahre war ich bei den Spontis. Unsere Analyse war: Die Arbeiterklasse hier profitiert von der Ausbeutung der dritten Welt und ist durch den Konsum korrumpiert. Man konnte damals ja in ein Temporärbüro gehen und hat am nächsten Morgen ordentlich verdient. Interessanter schien uns, die Alternativgesellschaft aufzubauen. Die Schweiz des Kalten Kriegs war recht homogen mit einer Schicht, die das Land regierte, und wir sahen uns als Gegenpol. Das zweite war, dass wir glaubten, der Fortschritt finde in den Befreiungskriegen der dritten Welt statt. Damals hatten sich ja erst die letzten Länder vom Kolonialismus befreit. Ich ging in die RS, weil ich zur Guerilla in Lateinamerika wollte. In Nicaragua war ich in einer Solibrigade beim Kaffeepflücken. Eine der interessanten Erkenntnisse war: Hat man, wie damals die Sandinistas in Nicaragua, die Revolution gewonnen, muss man ganz prosaische Sachen wie das Abfuhrwesen organisieren. Durch das Reisen in Drittweltstaaten entdeckte ich den Sexappeal funktionierender Gesellschaften.
Du meinst nach dem Vorbild der Schweiz?
Ja. Es ist ein Privileg, dass man als Mann oder Frau nachts angetrunken durch die Stadt laufen kann, ohne ständig Angst zu haben, dass einem etwas passiert. Man dreht am Hahn und es kommt trinkbares Wasser raus. Du kannst überall relativ schnell hinfahren. Die Luft ist einigermassen sauber. Es funktioniert, gemessen am Rest der Welt, vieles recht gut.
Also eine totale Absage an utopische Entwürfe?
Utopie heisst ja der Nicht-Ort. Das, was es nicht gibt. Mich interessieren aber die konkreten Probleme. Die grosse Kiste, das sind momentan die ganzen Abwehrkämpfe gegen die extreme Rechte, die Nationalkonservativen, die Populisten. Das ist natürlich ziemlich unromantisch, wir leben in einer nüchternen, utopiefreien Zeit. Mein politisches Engagement gilt seit Langem – etwa mit der Abstimmungsplattform votez.ch –, dem Kampf gegen die SVP. Es ist noch immer unklar, ob man es in Europa schafft, die EU, diesen recht zivilisierten Grossraum, zusammenzuhalten. Oder ob wir in die ganze Nationalstaaterei zurückfallen. Dann wird es wirklich ungemütlich. Das wird keine Utopien befördern, sondern eher das Gegenteil, nämlich Dystopien.
«Die Gentrifizierung bin ich: Beichte eines Finsterlings» spielt im Riffraff.
Nichts verpassen mit dem Tsüri-Mail
Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
- Gentrifizierung der Langstrasse: Hiltl, Kosmos & Co sind «nur» mitschuldig
- »
- »
- Zürich West – Geschichte einer gescheiterten Urbanität
- Nach Machtdemonstration: Jetzt müssen die Linken und Progressiven mutig sein
- Verein «Noigass» lanciert Volksinitiative für 100% günstige Wohnungen
Titelbild: Screenshot/Youtube
Dieser Artikel wurde automatisch in das neue CMS von Tsri.ch migriert. Wenn du Fehler bemerkst, darfst du diese sehr gerne unserem Computerflüsterer melden.